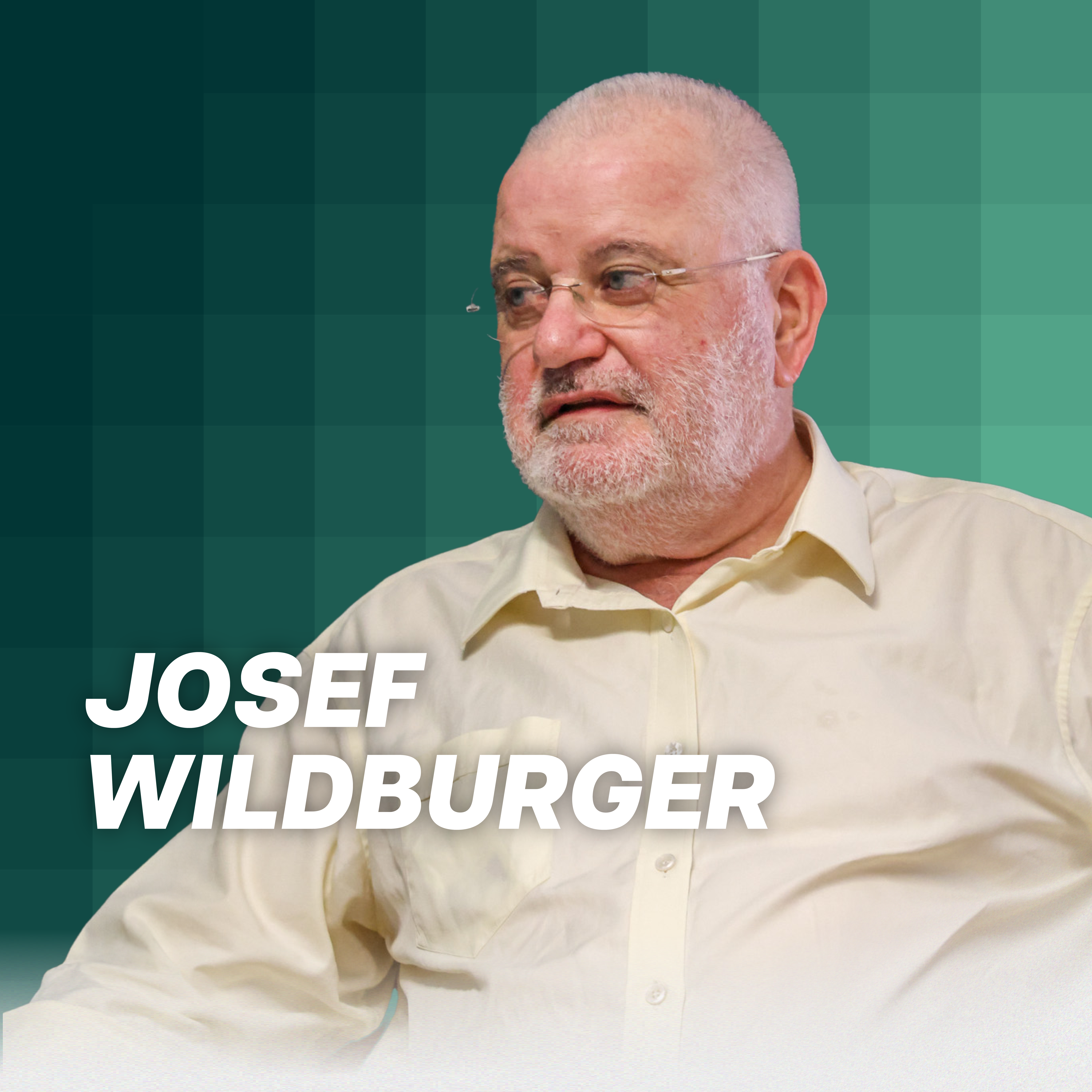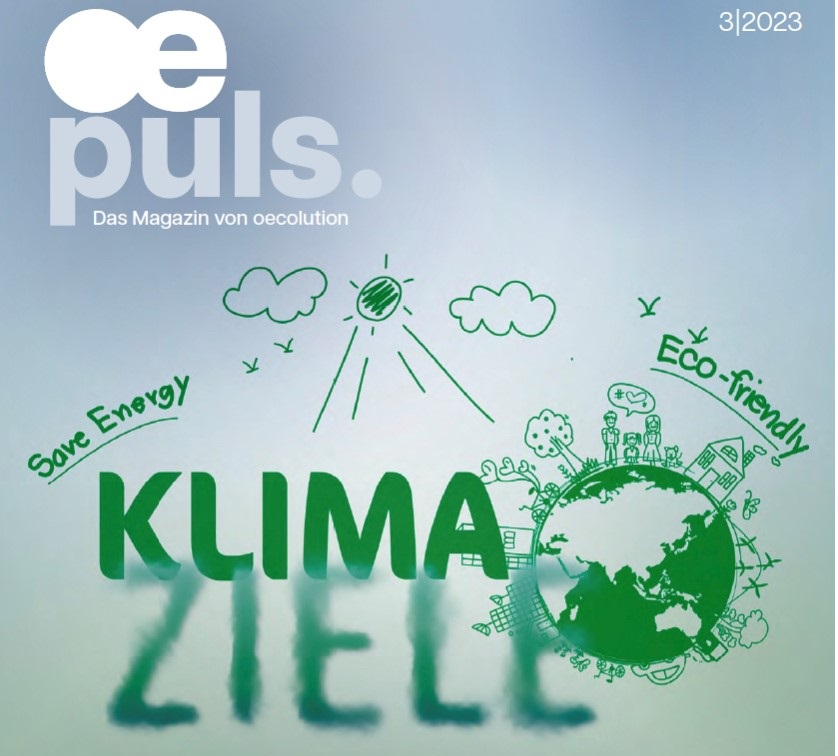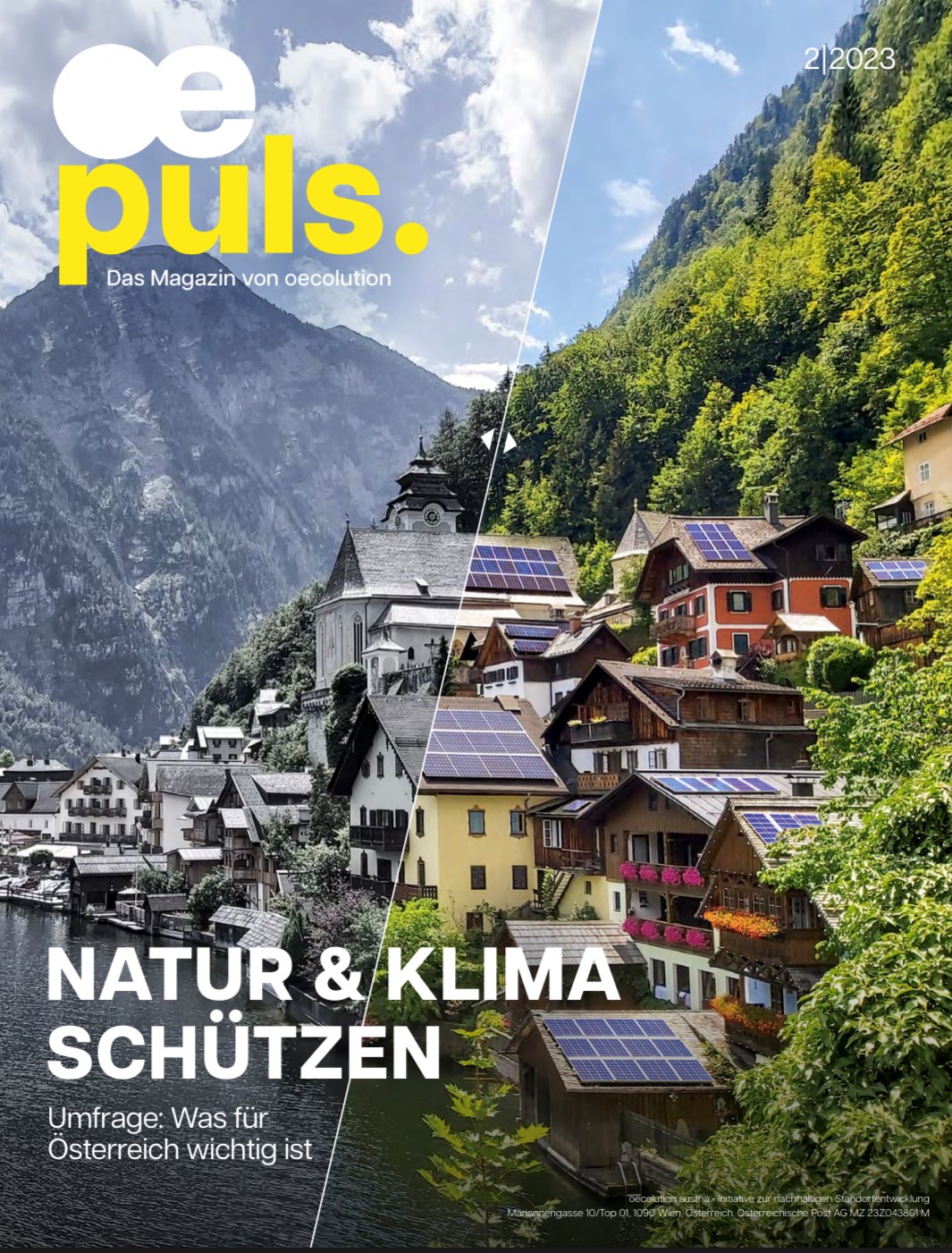Strom bleibt auch 2025 ein Kostentreiber. Sowohl Unternehmen als auch Privathaushalte spüren die Belastung durch hohe Strompreise deutlich. Besonders kleine und mittlere Betriebe leiden unter den im internationalen Vergleich überdurchschnittlich hohen Stromkosten. Die steuerliche Belastung entwickelt sich zunehmend zu einem Standortnachteil und gefährdet damit die Wettbewerbsfähigkeit heimischer Unternehmen. Auch private Haushalte zahlen 2025 spürbar mehr – Grund dafür sind vor allem das Auslaufen staatlicher Entlastungen sowie gestiegene Abgaben und Netzkosten. Österreich findet sich als EU-Spitzenreiter bei den Elektrizitätsabgaben wieder.
Strompreise auf Rekordniveau – kaum Entlastung für Betriebe
Die EU sieht für Unternehmen einen Mindeststeuersatz von 0,05 Cent pro Kilowattstunde (c/kWh) vor. In Österreich liegt diese Steuer aktuell bei 1,5 c/kWh – das ist der zweithöchste Wert innerhalb der EU. „Die Stromsteuer für Unternehmen ist 30-mal höher als der EU-Mindestsatz. Das ist Gold-Plating der Extraklasse“, kritisiert Christian Tesch, Geschäftsführer von oecolution.
Für kleinere und mittlere Unternehmen mit einem jährlichen Stromverbrauch unter 20.000 Megawattstunden liegen die Gesamtkosten für Strom 2025 bei rund 23,6 c/kWh – nur knapp unter dem Rekordwert von 2023 (23,9 c/kWh). Obwohl die Preise seit den Höchstwerten von 2023 etwas zurückgegangen sind, führen die inzwischen deutlich höheren Netzkosten dazu, dass das Kostenniveau 2025 rund zehn bis 13 Cent über dem Vorkrisenstand liegt.
Auch bei energieintensiven Unternehmen (Verbrauch über 20.000 MWh jährlich) zeigt sich ein ähnliches Bild: Durch erhöhte Netzkosten (2,3 c/kWh) und weiterhin hohe Marktpreise ergibt sich eine Gesamtbelastung von rund 16,4 c/kWh – das sind knappe 6 Cent mehr als 2021. Tesch warnt: „Die Energiewende braucht leistungsfähige Unternehmen, die die Kraft für Investitionen haben.“
Energiesteuern als Kostentreiber – und Wettbewerbsnachteil
Laut einer aktuellen Analyse liegt Österreich (mit 1,5 c/kWh) bei der Elektrizitätsabgabe an der europäischen Spitze – lediglich Frankreich erhebt einen höheren Satz (2,62 c/kWh). Die Niederlande sind in dem Vergleich ausgenommen, da es für Unternehmen eine pauschale Rückvergütung gibt. Die Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten hingegen orientiert sich am Mindestwert oder liegt nur geringfügig darüber.
Auch im internationalen Vergleich stehen heimische Unternehmen schlecht da: Die Stromkosten in Österreich übersteigen jene in China, Indien, Kanada oder den USA deutlich – ein klarer Nachteil für den Wirtschaftsstandort. „Das schadet der Wettbewerbsfähigkeit und damit dem Standort Österreich“, betont Christian Tesch.
Forderung: Senkung der Elektrizitätsabgabe auf EU-Mindestniveau
Die österreichische Energiepolitik läuft Gefahr, Unternehmen durch überhöhte Stromkosten wettbewerbsunfähig zu machen. Während andere Staaten ihre Betriebe entlasten, sorgt das „Gold Plating“ – also die Übererfüllung europäischer Mindestvorgaben – für eine unnötige Belastung des Standorts Österreich. Gerade in Zeiten, in denen viele Branchen ohnehin unter hohem internationalen Wettbewerbsdruck stehen, ist es essenziell, die Kosten nicht künstlich in die Höhe zu treiben. Eine steuerliche Entlastung bei den Energiesteuern wäre eine einfache und gezielte Maßnahme, um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, die Inflation zu dämpfen und Investitionen in den Standort Österreich zu fördern. Darüber hinaus wird durch die heimische Produktion das Klima geschützt. „Produktion in Österreich ist CO2-schonender als anderswo. Daher sollten wir die Produktion nicht mit hohen Stromsteuern vertreiben. Das führt nur zu Carbon Leakage und schadet dem Klima“, erläutert Tesch.
Haushalte: Strompreise steigen auch privat deutlich
Auch Privathaushalte sind stark betroffen: Mit 1,8 c/kWh liegt die Elektrizitätsabgabe im oberen Drittel im EU-Vergleich und damit deutlich über dem EU-Mindestsatz von 0,1 Cent. Auch hier orientieren sich die meisten anderen EU-Länder am Mindestwert. Zusätzlich zum reinen Strompreis zahlen Haushalte derzeit etwa 1,6 Cent pro Kilowattstunde zur Förderung erneuerbarer Energien sowie durchschnittlich 0,2 Cent für weitere Abgaben. Insgesamt ergeben sich daraus rund 3,3 Cent pro Kilowattstunde an direkten strombezogenen Abgaben.
Da die Mehrwertsteuer auf sämtliche Kostenbestandteile – also auf Strompreis, Netzentgelte und sämtliche Abgaben – erhoben wird, entfällt der größte Teil der steuerlichen Belastung mit etwa 5,9 Cent pro Kilowattstunde auf die Umsatzsteuer. Insgesamt summieren sich die steuerlichen Abgaben somit auf rund 9,2 Cent pro Kilowattstunde. Während in den Jahren 2023 und 2024 Entlastungen wie die Strompreisbremse und Netzkostenzuschüsse galten, entfallen diese 2025 größtenteils. Das hat spürbare Folgen: Lagen die Nettokosten 2024 noch bei durchschnittlich 17,4 c/kWh, steigen sie 2025 auf rund 35 c/kWh – mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr und rund 13 Cent mehr als 2021. Es braucht Entlastung für Unternehmen und Haushalte, denn: „Die Energiewende braucht die Unterstützung der Bürger. Die gibt es nur, wenn die Strompreise endlich wieder runterkommen“, schließt Tesch.
Die Analyse hier zum Nachlesen: https://jetzt.oecolution.at/steuern-auf-strom